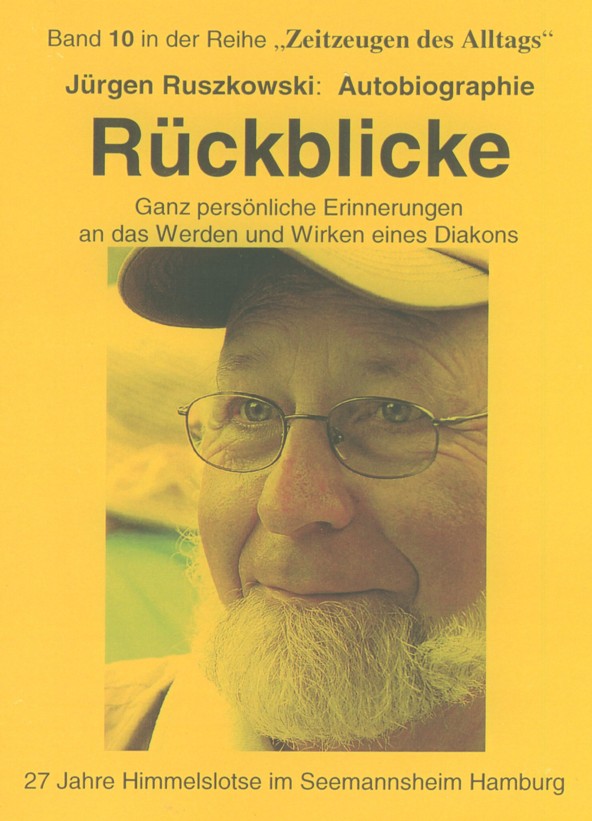Kindheit
Biographie des Webmasters:
|
Rückblicke - ganz persönliche Erinnerungen an das Werden und Wirken eines Diakons - trägt den Untertitel 27 Jahre Himmelslotse im Seemannsheim in Hamburg |
Ein Beitrag aus Band 10
der gelben Buchreihe Zeitzeugen des Alltags von Jürgen Ruszkowski
- Band 10e-1 -
- Band 10-1 - Diakon Ruszkowski -
Ganz persönliche Erinnerungen - Herkunft, Kindheit...
bei epubli.de online oder über den Buchhandel zu bestellen
ISBN: 9783748537748
Reste aus Eigendruck - Verkaufspreis: 13,99 €
|
Inhalt der Autobiographie: Sieht man ihm den späteren Seemannsdiakon schon an? |
Selbstbildnis in Ton |
|
Herkunft - Vater - Mutter - Vorfahren My Childhood - meine Familie - |
|
Stätten meiner Kindheit - Stettin - Kindheit - Stadt Stettin
My Background Cities and Scenes of Stettin, - Bergstraße 6 Die ersten vier Jahre ab 1935 My Childhood - Herkunft - Vorfahren |
|
|
Bei Ruszkowskis in Stettin, Bergstraße Großvater Julius - Großeltern Ruskowski
|
Stettin
Stettin
- Stettiner Hafen -
Stettin und Umgebung vor 1945
Stätten meiner Kindheit und Herkunftslandschaft
Vier Jahre lang waren meine Eltern verlobt. Dann wurde in Stettin in der Bergstraße 6 (heute OWOCOWA), wo mein Vater bei seinen Eltern lebte, in der 2. Etage eine Wohnung frei. Karl erklärte, jetzt sei die Zeit zum Heiraten gekommen: 1933, Vater war 27, Mutter 22 Jahre alt, war dann Hochzeit bei ungewisser Zukunft: Man startete gemeinsam trotz Arbeitslosigkeit und lebte schlecht und recht vom Stempelgeld. Dieses wurde immer weiter gekürzt. Zum Schluss gab es nur noch 12 Reichsmark wöchentlich. Aber meine Mutter konnte durch Näharbeiten hinzuverdienen und Schwiegermutter Johanna Ruszkowski sorgte für Kundschaft. Als Karl ihr einmal sagte, sie könne ja sehr viel, nur kochen könne sie nicht, nahm sie sich das sehr zu Herzen und unternahm alles, um diese Lücke zu schließen. Ihre Mutter war gelernte Köchin gewesen und hatte das Nesthäkchen nie an den Herd gelassen.
Mein Vater bekommt im Februar 1934 eine Stelle als Telegraphenarbeiter bei der Deutschen Reichspost mit einem bescheidenen Einkommen und wird später Postkraftfahrer. Der Wochenlohn beträgt anfangs satte 36 Mark! Für die Miete zahlt man im Monat 40,- Mark. Die gute Stube wird für 20,- DM an Vaters Tante untervermietet. Vater ist anfangs häufig die Woche über mit dem Bautrupp auf Montage unterwegs.
In diesem Hause begann Mitte Januar 1935 alles:

St.-Carolus-Stift in Stettin
Vater, Mutter, Großmutter Johanna, Großvater Julius, Onkel Werner Ruszkowski
Ich werde von Oma regelmäßig im Kinderwagen ausgefahren, mit Bananen gefüttert und später mit kleingehackten Bonbons vollgestopft. Während meiner Trotzphase bringt meine Mutter mich nie an Omas Wohnungstür vorbei. Oma hat ein sehr gutes Gehör und ist sofort zur Stelle, wenn ich brülle. Dann gibt es natürlich sofort ein Bonbon. Wenn meine Mutter Besuch von einer Freundin erhält, merkt Oma Johanna es sofort und will mitreden. Auf die Dauer ist diese allzu intime Aufdringlichkeit der Schwiegermutter nicht durchzustehen. So bewirbt sich Vater Karl 1937, als er 31 und Mutter Erna 26 ist, um eine Versetzung als Telegraphenbauarbeiter nach Altdamm, einem Vorort Stettins östlich der Oder, und findet dort am August-Frost-Weg nahe am Waldrand parallel zur Stargarder Straße, nicht weit von der Papierfabrik entfernt, eine schöne Neubauwohnung mit Balkon und Ausguss im 1. Stockwerk, das erste eigene, unabhängige Zuhause. In der Etage über uns wohnt Heinzi Navin, mit dem ich oft spiele. Durch die waldnahe Lage unserer Wohnung in Altdamm halte ich mich, meist mit anderen Kindern zusammen, viel im Grünen auf. Fortan werde ich immer eine besondere Liebe zum Wald haben.
Mein Vater soll mit seinem Telegraphenbautrupp für mehrere Wochen nach Bayern versetzt werden, um in dem damals noch unterentwickelten Südstaat Entwicklungshilfe zu leisten. Mutter Erna setzt durch, zusammen mit mir mitreisen zu dürfen. Von Straubing aus werden am Wochenende Ausflüge mit geliehenem Pkw auf den Großen Arber im Bayerischen Wald, an den Königssee im Berchtesgadener Land, nach Braunau am Inn zu Führers Geburtshaus und ins Sudetenland unternommen. Es ist eine wunderschöne Zeit, an die ich mich noch bruchstückweise erinnern kann.
Krieg
Am 1. September 1939 bin ich vier Jahre alt. Unser Führer, der „große Feldherr“ Adolf, Gastarbeiter aus Braunau in Österreich, verkündet über den Volksempfänger im Wohnzimmer, es werde in Danzig seit 5 Uhr in der Früh „zurückgeschossen“. Meiner Mutter Vater war im 1. Weltkrieg gefallen. Sie weiß also, was Krieg bedeutet. Ich kann mich an ihre Angst bei Kriegsbeginn vor der „Goebbelsschnauze“ gut erinnern.
Außer im Wald strolchen wir Kinder auch über den nahegelegenen Truppenübungsplatz und spielen „Soldat“. Einmal gibt es im nahen Wald einen großen Menschenauflauf. An einem Baum wird ein Pole erhängt, der irgend ein „Verbrechen“ an Deutschen begangen haben soll. Die in Lagern gefangengehaltenen polnischen „Fremdarbeiter“ müssen „zur Abschreckung“ in langen Kolonnen unter dem Gehängten vorbeidefilieren. Ich erinnere mich auch noch daran, dass sich eines Tages vor einem Haus in unserer Straße ein Drama abspielte, indem die Obrigkeit einen geistig behinderten jungen Mann gegen den Willen der Mutter „abholte“.
Mein Schulweg führt mich an einem Gefangenenlager für russische Kriegsgefangene vorbei, die damals als Untermenschen gelten und erheblich schlechter behandelt werden als gefangene Engländer und Franzosen.
Sieben Jahre lang wachse ich als Einzelkind auf. 1942, meine Mutter ist 31 Jahre alt, ich 7, wird meine Schwester Inge-Lore geboren. Ich verbringe die Zeit, bis die Mutter wieder aus dem Krankenhaus zurück ist, bei den Verwandten meiner Mutter in Lübzin (siehe Autobiographie).
Dort auf dem Bauernhof bei Oma Martha Dollerschell, Tante Frieda, Onkel Hermann Tank und Vettern Manfred und Herbert bin ich gerne zu Besuch. Mit dem Pferdewagen fahre ich mit auf die Wiesen, wo mit der Sense frisches Grünfutter für die Kühe gemäht wird. An den Festtagen gibt es bei Tante Frieda zum Mittagsmahl frische Schoten-Erbsen mit Möhren oder grüne Bohnen mit Bohnenkraut. Vetter Herbert, der kein Gemüse mag, versucht vergeblich, mir die Bohnen mit der Bemerkung madig zu machen, aus Wachsbohnen mache man Bohnerwachs. Zum Nachtisch gibt es Pudding, in Pommern „Speise“ genannt, in Farbschichtung: rot und gelb. Im Herbst verströmen die in einer Bodenkammer lagernden Äpfel aus dem Bauerngarten einen bezaubernd süßwürzigen Duft. - Gleich nebenan wohnt Harald Fick, ein gleichaltriger Junge, mit dem ich bei meinen Besuchen gerne zusammen bin. Er verfügt über ganze Heerscharen von Tonsoldaten, dem für Jungen damals wichtigsten Spielzeug. Spielerisch schon sollen künftige Helden heranwachsen! - Wir fahren von Altdamm aus entweder per Fahrrad über Sandwege nach Lübzin oder mit der Bahn bis Stettin und von dort vom Oderbollwerk an der Hakenterrasse aus mit dem Dampfer über den Dammschen See. Einmal setze ich auch alleine mit dem Dampfer über. Den Öl- und Kohlenrauchgeruch der Maschine und deren rhythmische Geräusche habe ich noch heute deutlich in Erinnerung.
Mein Vater wird kurz darauf zusammen mit seinem gesamten Bautrupp zu einer Nachrichteneinheit als Soldat eingezogen und weilt relativ gefahrlos im blitzkriegbesiegten Frankreich, längere Zeit im Mittelmeer-Kriegshafen Toulon. Erst auf dem Rückzug nach der Invasion gerät er in lebensbedrohliche Tiefflieger-Attacken und Bombardements.
Der Krieg kommt auch an die „Heimatfront“: Immer öfter muss meine Mutter mit uns Kindern nachts in den Luftschutzkeller. Im Herbst 1943 sollen wir, ich war acht Jahre alt, mit meiner Schule wegen des Bombenkrieges nach Grimmen in Vorpommern evakuiert werden.
In Dischenhagen im Kreis Cammin lebte ich von 1943 bis März 1945 auf dem Bauernhof meines Onkels Walter Dollerschell
So werden wir vor den immer heftigeren Bombardements verschont. Einen schweren Angriff erlebe ich im Luftschutzkeller in Stettin mit, als ich Oma Ruszkowski von Dischenhagen aus alleine im Alter von neun Jahren besuche. In Hinterpommern können wir die „anglo-amerikanischen Bomberverbände“ in großer Höhe am blauen Himmel in Schwärmen silbern glitzern sehen und das schauerliche Dröhnen der vielen Motoren hören, nachdem die Bombenlast über Stettin und den Pölitzer Benzinwerken abgeworfen worden war. Die Rauchschwaden von Pölitz verdunkeln auch bei uns den hinterpommerschen Himmel. Ansonsten ist es in Dischenhagen bis Anfang 1945 paradiesisch ruhig. Für mich sind die beiden Jahre in dem stillen Dorf idyllisch. Ich befreunde mich mit einem gleichaltrigen Jungen von einem Nachbarhof. In der kleinen Dorfschule mit nur zwei Klassen werden gleichzeitig mehrere Jahrgänge unterrichtet. Hier wird mir das kleine Einmaleins beigebracht. Der Dorfschullehrer hat noch einen Rohrstock, von dem er des öfteren Gebrauch macht. Auf dem Hof meines Onkels leben seine Frau, Tante Erna, deren zweijährige Tochter, meine Cousine Ruth, und meine Großtante Emma. Außer uns ist noch Frau Irmgard Jaeger aus Hagen in Westfalen mit ihrer kleinen Tochter Ulla als Evakuierte einquartiert. Wir leben alle in enger Lebensgemeinschaft auf begrenztem Raum und aus einem Kochtopf und beteiligen uns an den täglichen landwirtschaftlichen Arbeiten, die vor allem von Tante Erna und dem polnischen Fremdarbeiter Jan erledigt werden.
Ein Ackerpferd, das, wenn es Koliken hat, auf dem Hof immer in die Runden getrieben wird, steht für die Arbeiten zur Verfügung. Auf dem Hof liefern etwa sechs Kühe die Milch, einige Schweine das Fleisch und die Hühnerschar die Eier. Es wird auch ein schwarzer Schafbock gehalten, dessen fettige, duftende Wolle die alte Tante Emma nach dem Waschen und Auskämmen am Spinnrad strickfertig macht. Ich hüte des öfteren die Kühe. Einmal gerät mir dabei eine Kuh in ein sumpfiges Loch. Das ergibt eine große Aufregung. Die Kuh kann daraus nur mit großer Mühe befreit werden. - In den Sommermonaten sammeln wir im Wald viele Blaubeeren, Preiselbeeren und Pfifferlinge. - An heißen Sommertagen baden wir Kinder in der Stepenitz, einem kleinen Flüsschen. - Nachdem im August die Roggenernte und im Oktober die Kartoffelernte eingefahren ist, wird in der Scheune die Dreschmaschine in Gang gesetzt und mit ohrenbetäubendem Lärm und viel Staub das Korn gedroschen. - Es wird auch selber auf dem Hof ein Schwein geschlachtet, Wurst gekocht und auf dem Dachboden geräuchert. Im Winter wird das Pferd vor den Schlitten gespannt und die Fahrt geht durch die verschneiten Wälder.
Der Krieg geht fast spurlos an uns vorbei. Von der bevorstehenden Katastrophe bekommen wir nichts mit. Der Radioapparat auf dem Hof ist defekt und die gleichgeschaltete großdeutsche Presse ohnehin bis zum letzten Tag auf Siegesoptimismus geschönt. Im Sommer 1943, meine Mutter ist 33, sieht sie ihren Lieblingsbruder Walter zum letzten Mal, als sie ihn mit Pferd und Wagen durch den Wald nach dem Fronturlaub zum Bahnhof Honigkaten fährt. Auf dem Wege offenbart er ihr, dass er den Krieg für verloren und Hitler und seine Helfer für Verbrecher hält. Er habe in Russland zu viel gesehen: „Vom Unteroffizier aufwärts sind das alles Schweine. Diesen Hunden gönn’ ich den Sieg nicht. Ich hab’ das Gefühl, ich komm’ in russische Gefangenschaft und da nie wieder raus.“ Er setzt sich dafür ein, dass an den polnischen Zwangsarbeiter Jan, der während seiner kriegsbedingten Abwesenheit vom Hof die landwirtschaftlichen Arbeiten erledigen muss, gut behandeln soll. Seine Frau, Tante Erna, die Jan sonst recht kurz zu halten pflegt, liegt während Walters Fronturlaub mit einer infektiösen Erkrankung im Krankenhaus Gollnow auf der Isolierstation und er kann sie nur von der Straße aus in Rufweite sehen. Seine letzte Post kommt im August 1944 aus Rumänien, bevor die Rumänen sich von Deutschland ab und den Sowjets zuwenden. Das besiegelt auch sein Schicksal. Er gilt seither als „vermisst“.
Im Januar 1945 ist mein Vater noch einmal als „Fronturlauber“ zu Hause. Zu der Zeit erhalten wir in Hinterpommern die ersten nächtlichen Einquartierungen von Flüchtlingstrecks aus Ostpreußen, die am nächsten Morgen wieder weiterziehen. Der gummibereifte Pferdewagen wird, als die Front immer näher rückt, mit einer Plane versehen und für die Flucht mit den wichtigsten Sachen, wie Bettzeug, Kleidung und Lebensmittelvorräten beladen. Porzellan, Bestecks und Wertsachen werden in Kisten verstaut und im Garten hinter dem Haus vergraben. Wenn wir nach dem Kriege (Hitler glaubt offenbar immer noch an den Endsieg und schickt zu dieser Zeit noch deutsche Truppen, die zum Aufhalten der Russen in der eignen Heimat dringen nötig gewesen wären, nach Ungarn, um die Bolschewiken von dort aus in die Zange zu nehmen) zurückkehren werden, wollen wir die Sachen wieder hervorholen. Aus Bettlaken näht meine Mutter Rucksäcke. Am 28. Febrauar fahren wir noch sorglos zur Konfirmationsfeier meines Vetters nach Lübzin. Am 4.3. sehen wir in der Nacht im Nordosten Feuersschein am Horizont und wundern uns darüber. Niemand ahnt, dass er schon die nahen brandschatzenden Russen ankündigt, die mit überwältigender Übermacht nur auf geringen Widerstand stoßend, in wenigen Tagen große Gebiete überrennen. Die Flucht darf erst nach obrigkeitlicher Weisung angetreten werden. Im kalten frühen März 1945 kommt die behördliche Anordnung: Evakuierte dürfen am 4. März den Ort verlassen, Ortsansässige haben noch zu bleiben. Ich bin 10 Jahre alt, meine Mutter 34, mein Vater als Soldat auf dem Rückzug im Westen. Wäsche wird doppelt und dreifach auf den Körper gezogen, die gepackten, aus Bettlaken genähten Rucksäcke werden geschultert. Tante Erna bringt uns (am 4. März) mit dem Pferdewagen zum Bahnhof Kantreck. Dort langes vergebliches Warten auf einen Zug (den ganzen Tag und die darauffolgende Nacht). Mehrere Flüchtlingszüge fahren ohne uns weiter. Zwischendurch werde ich noch einmal zu Fuß über die Kleinbahngleise zurückgeschickt, um irgend etwas Vergessenes zu holen. Meine Mutter erwartet derweil besorgt meine Rückkehr. In der Nacht der feuerrote Horizont im Nordosten. Die Russen melden sich schon per Telefon aus der nächsten nördlichen Bahnstation (Cammin wurde um den 5./6.3. bedrängt, um den 5.3. setzten sich deutsche Militärdienststellen aus Hammer ab. Hagen vor Wollin wurde am 7.3.von den Russen eingenommen). Es gelingt uns (es muss am 5.3. gewesen sein), im letzten Eisenbahnzug dank der beherzten Durchsetzungsfähigkeit der Mitevakuierten und späteren Freundin der Familie, Irmgard Jaeger aus Westfalen, die Türen einer offenen Kohlenlore von außen zu öffnen und uns gegen den heftigen Widerstand der bisherigen „Passagiere“ Einlass zu verschaffen. Wenige Stunden später rücken die Russen ein. Die Flucht im unbedachten Güterwagen, den Russen noch gerade im letzten Augenblick entkommen, führt uns durch das brennende Altdamm und Stettin immer weiter nach Westen. Für die Strecke bis Stettin, die man sonst mit dem Bummelzug in einer Stunde fuhr, benötigt unser Flüchtlingszug eine Woche. Immer wieder bleibt er auf freier Strecke stundenlang stehen, bis die zerbombten Schienen wieder notdürftig repariert worden sind (vermutlich fanden bereits unweit der Bahngleise Kämpfe statt: Gollnow wurde am 7.3. von den Russen bedroht, Lübzin am 8.3.1945. Bei Hornskrug stürmten die Sowjets am 11.3. gegen den bis zum 20.3. von den Deutschen gehaltenen Brückenkopf Altdamm). Es ist riskant, den Zug zu verlassen, etwa um ein menschliches Bedürfnis zu erledigen. Er kann nach kurzem Pfeifen der Lokomotive jeden Moment wieder anfahren. Die russischen „Nähmaschinen“ (Jagdflugzeuge) beharken auf der parallel laufenden Landstraße die zurückflutenden deutschen Militärkolonnen mit Maschinengewehrfeuer, verschonen aber unseren Flüchtlingszug (Lange steht der Zug auch vor Altdamm und meine Mutter überlegt ernstlich, dort auszusteigen). Von Stettin aus geht es dann an einem Tag durch bis an unser Ziel, das uns aber noch unbekannt ist. Nur ab und zu hält der Zug, um einige Kinderleichen oder an Erschöpfung gestorbene alte Leute auszuladen. Ein Mann in SA-Uniform reicht unterwegs den durstigen Flüchtlingen auf deren Bitte einen Eimer mit Trinkwasser aus einem Bahnwärterhäuschen in den Waggon. In Grevesmühlen in Westmecklenburg, kurz vor Lübeck, hält der Zug und wir müssen alle aussteigen. Eine Woche lang finden wir zusammen mit vielen anderen Flüchtlingen ein erstes Notquartier in der Fremde im evangelischen Gemeindesaal auf einem Strohlager. Am nächsten Tag kann ich nicht mehr laufen. Meine im offenen Güterwagen angefrorenen Füße heilen aber langsam wieder. Einem Altersgenossen müssen die erfrorenen Zehen amputiert werden. - Dann erhalten wir zusammen mit Irmgard Jaeger und deren Tochter Ulla für zwei Frauen und drei Kinder ein kleines Zimmer mit Strohsäcken auf dem Fußboden bei Malermeister Matthies in der Wismarschen Straße 67. Als meine Mutter in Grevesmühlen von dem geretteten Sparbuch Geld abheben will, ist keines mehr zu bekommen. Alle wollen hier Bargeld abheben, so dass die Sparkassen bald zahlungsunfähig sind.
Die in Dischenhagen zurückgebliebenen Verwandten werden, wie wir erst viel später erfahren, (vermutlich am 7.3.) von den Russen überrollt und erleben deren Vandalismus grauenvoll am eigenen Leibe. Als erstes buddeln sie unsere vor wenigen Tagen im Garten vergrabenen Kisten zielstrebig aus. Auf ihrem Vormarsch durch Ost- und Westpreußen haben sie darin schon hinreichend Erfahrung sammeln können. Die betrunkenen Russen holen die Flaschen mit eingeweckten Blaubeeren aus dem Keller und werfen sie gegen die Hauswand, weil sie keinen Wodka enthalten, zerren die Federbetten heraus und schlitzen sie auf, stochern mit Forken im Heu herum, worin sich die Frauen versteckt haben und feiern Orgien der Vergewaltigung. Dem sind wir noch gerade rechtzeitig entkommen!
1945 Flucht aus Dischenhagen in Pommern
- Band15e - Band 15 - bei amazon - Band 15 -
als Direct Deposit by On Demand Publishing, also als amazon-Direktdruck-Printbücher
nur noch bei epubli.de für 28,99 €
Kriegsende 1945 und die Folgen - Zeitzeugen erinnern...ISBN 978-3-746772-48-6 - Preis: 28,99 €
oder als ebook
Band 15 - ISBN 978-3-8476-8313-1
Deutsche Schicksale 1945 - Zeitzeugen erinnern
Band 15 - Wir zahlten für Hitlers Hybris -
Zeitzeugenberichte aus 1945
über Bombenkrieg, Flucht, Vertreibung, Zwangsarbeit und Gefangenschaft. -
| Grevesmühlen in Mecklenburg |
Der Krieg liegt in seinen letzten Zuckungen. Ich bin enttäuscht, dass ich nach Erreichen des 10. Lebensjahres in Grevesmühlen nicht mehr Pimpf werden soll, aber meine Mutter meint, das sei nun nicht mehr angebracht. Mit unserem Führer und seiner Hitlerjugend geht es trotz aller Endsiegparolen und Hoffnungen auf Wunderwaffen unzweideutig dem Ende entgegen. Der Traum von der Weltherrschaft des Großdeutschen Reiches ist ausgeträumt. Im April und Anfang Mai fluten in dieser letzten, von deutschen Truppen „beherrschten“ Gegend aus Ost und West deutsche Militärkolonnen und endlose Flüchtlingstrecks zusammen. Die Flüchtlinge biwaken in den Kohlsteigen und Gartenwegen mit ihren Pferdewagen, die Soldaten in Wäldern und auf Feldern. Der „Heldentod des Führers“ wird bekanntgegeben. Anfang Mai werden weiße Fahnen gehisst und man bedeutet mir, ich solle nun nicht mehr mit „Heil Hitler“ grüßen, das sei jetzt vorbei, was ich erst nicht verstehe, denn ich habe mit meinen zehn Lenzen gar nicht assoziiert, dass dieser Gruß etwas mit „unserem Führer“ zu tun hat. Für mich ist „heilitler“ gleichbedeutend mit „Guten Tag“. Es gibt um Grevesmühlen keine Kämpfe. Ein Haus wurde durch eine Bombe zerstört, die einer benachbarten Eisenbahnbrücke gegolten hatte und ihr Ziel verfehlte. Einige SS-Fanatiker holen die weiße Fahne wieder vom Wasserturm und es gibt eine wilde Schießerei zwischen ihnen und den hissenden Wehrmachtssoldaten. Warenlager werden plötzlich zum Plündern durch die Bevölkerung freigegeben.
Der Krieg ist aus
Der erste Jeep mit weißem Stern auf der Kühlerhaube fährt am 3. Mai 1945 durch unsere Straße. Die Amis sind kampflos da. Sie lassen durch einen Lautsprecherwagen in deutscher Sprache ausrufen, nachts gelte Ausgangssperre, diese Gegend sei sowjetisches Interessengebiet und niemand habe es zu verlassen. Fotoapparate und ähnliche Wertgegenstände sind auf dem Marktplatz an die Besatzungsmacht abzuliefern. Unser einfaches Klappbalg-Fotogerät, das die Flucht überstanden hatte, wandert somit „in Feindeshand“. Wir sehen die ersten „Neger“. Die Amerikaner werden durch Briten abgelöst und wir amüsieren uns über Soldaten in karierten Röcken mit Dudelsäcken, die auf dem Marktplatz paradieren. Die fremden Soldaten essen schneeweißes Brot und ab und zu erwischt ein deutsches Kind mal von ihnen ein Stück Schokolade. Rund um Grevesmühlen unterhalten die Tommys riesige Kriegsgefangenenlager auf Feldern unter freiem Himmel. Später erzählt uns Onkel Hermann, dass er in einem dieser Lager bei Grevesmühlen weilte. Den einzigen Schutz gegen Kälte und Regen bieten Erdlöcher. Die Schulen sind zu Lazaretts geworden. Von dort zieht fast jeden Tag ein Pferdewagen mit Leichen in Papiersäcken an unserem Haus vorbei zum Friedhof. Alle paar Tage geht der Gemeindebote mit seiner Handglocke durch die Straßen und ruft die neuesten Nachrichten der Militärverwaltung aus.
Mein Vater entledigt sich in Lübeck seiner Soldatenuniform und besorgt sich eine Postuniform. Damit wandert er die etwa 40 km bis Grevesmühlen, wo er noch im Mai bei uns eintrifft. Um ein Haar wäre es schief gegangen, denn die unterwegs kontrollierenden Engländer wissen nicht zwischen Post- und Soldatenuniform zu unterscheiden. Auch Hans Jaeger kann sich auf der Flucht vor dem Iwan nach Grevesmühlen durchschlagen. In unserem kleinen Zimmer muss nun auch noch Platz für zwei Männer geschaffen werden. Hans Jaeger bricht schon bald darauf trotz offiziellen Verbots mit seiner Familie gen Westen in die westfälische Heimat auf. Er hat Angst vor Gräueltaten der angekündigten Russen, denn er hatte an der Ostfront schon einiges gesehen und gehört. Wir sind ja immer noch von der Hoffnung beseelt, in die pommersche Heimat zurückkehren zu können und wollen nicht noch weiter westwärts, auch sind wir froh, hier im westlichen Mecklenburg ein Dach über dem Kopf zu haben.
Im Sommer, am 30.6.1945, bin ich zum Erbsenpflücken auf einem nahegelegenen Gut auf dem Feld, als es plötzlich heißt: „Sofort nach Hause: Ausgangssperre.“ Die Briten ziehen ab, jetzt übernehmen die Russen unser Gebiet. In der folgenden Nacht kommen zunächst einige mit russischen Soldaten beladene altertümlich wirkende Lkws und dann unendliche Panjewagen- und singende Marschkolonnen mit einem Vorsänger und dann einfallendem Kollektivgesang. Ein russischer Liedversrefrain klingt für uns wie „Leberwurst, Leberwurst mit bisschen Sand damang“. Die sowjetischen Truppen sind in dem neu eingenommenen westmecklenburgischen Städtchen zwischen Wismar und Lübeck nicht mehr so wild wie im Kampfgebiet, das sie selber erobert hatten. Einzelne Übergriffe soll es hier und da auf den abgelegenen Dörfern geben. Im benachbarten Schützenhaus ist eine Blaskapelle stationiert und übt mit Hingabe und täglich neu den Triumphmarsch von Verdi. Russische Patrouillen durchsuchen die Häuser nach ehemaligen deutschen Soldaten. Meinem Vater passiert jedoch nichts. Er ist heil durch den Krieg gekommen und von Gefangenschaft verschont geblieben und bleibt es auch weiterhin.
Mit einem Handwagen ziehen wir in die Wälder und suchen auf dem Waldboden liegende Zweige, Reisig, Tannenzapfen und roden Baumwurzelstubben als Feuerholz für Herd und Ofen. Die Russen holzen die Wälder für ihren Bedarf ab und sägen die Bäume nach ihrer Weise in bequemer Brusthöhe ab, so dass wir uns gerne die verbliebenen Meter-Stücke über den Wurzeln holen. Einer der holzfällenden Russen spricht etwas deutsch und vermittelt uns radebrechend seine politische Weltanschauung: „Gitler Scheiße, Stalin Scheiße, alles Scheiße!“
In der unmittelbaren Nachkriegszeit wüten Krankheitsepedemien, die wegen fehlender Medikamente und mangelnder Hygiene nicht eingedämmt werden können. So verlieren wir im Sommer 1945 durch eine tödlich verlaufende Diphtherie meine Schwester Inge-Lore im Alter von drei Jahren, weil kein Serum zur Verfügung steht.
Mein Vater schlägt sich noch einmal bis nach Stettin durch, wo seine Eltern noch immer unter polnischer Verwaltung in ihrer alten Wohnung leben. Dort hat sich ein Pole mit dem deutschen Namen Müller mit einquartiert, der sie um ihren polnischen Namen beneidet und sie mit dem Gerücht zum Bleiben animiert, die Deutschen würden wieder zurückkommen. So lehnen sie Vaters Angebot ab, sie mit gen Westen zu nehmen. 1947 werden sie von den Polen dann Hals über Kopf ausgewiesen. Opa Julius verstirbt 70jährig auf der Fahrt von Stettin in den Westen an einem Schlaganfall und Oma Johanna kommt zu uns nach Grevesmühlen, wohnt zunächst mit in unserer kleinen Wohnung in der Bahnhofstraße und später in einem Altersheim. Oma ist überzeugte Anhängerin der „Bibelforscher“, um so mehr, nachdem ihr zweiter Sohn, Werner, mein Patenonkel, als Mitglied der Waffen-SS im „Polenfeldzug“ sein Leben „für Führer, Volk und Vaterland“ gelassen hatte. Von da an mochte sie von „unserem Führer“ gar nichts mehr wissen. Onkel Werner war weniger aus Überzeugung als vielmehr, um der Arbeitslosigkeit zu entkommen, bei der SS gelandet.
Schlangestehen und stundenlanges Warten auf ein Brot vor dem Bäckerladen, vor der Molkerei für eine Kanne voll Molke oder Magermilch, bei der Mühle für einen Beutel voll Kleie oder Schrot, gehören zum Alltag. Der Tannenberg-Müller ist als Original bekannt. Oft gibt es erst Ware, wenn der Chor der in der Schlange Wartenden ihm vorsingt: „Das Wandern ist des Müllers Lust“. Für den Kuss einer schönen Frau gibt es eine Extrazuteilung. Pferdefleisch in Form von Sauerbraten oder Frikadellen steht obenan auf der Leiter besonderer Genüsse. Die vielen Gäuler vor den Treckwagen aus den verlorenen deutschen Ostgebieten und übriggebliebene Militärpferde finden kein ausreichendes Futter mehr und daher den Weg ans Schlachtermesser. Ein großes Problem ist die Beschaffung von Schuhen, besonders für wachsende Kinder. Unter alte, irgendwo jahrelang in einer Bodenecke verstaubte Schuhe aus hartem, ausgetrocknetem Leder werden Holzsohlen genagelt. So kann man sich bei Wind und Wetter wenigstens draußen bewegen.
Vater findet bald Arbeit in einer Autoschlosserei und kurz darauf wieder als Kraftfahrer bei der Post. Seine ersten Autos werden wegen Benzinmangels noch mit Holzgas angetrieben. Wir haben daher immer genügend Holz zum Heizen und Kochen. Sein Job als Kraftpostomnibusfahrer trägt dazu bei, dass Passagiere vom Lande Eier und Speck springen lassen, um einen der begehrten Sitzplätze für die Fahrt in die Stadt zu ergattern. Die Mangel- und Hungerzeit nach dem Krieg überleben wir nicht unwesentlich durch meiner Mutter Näh- und Strickkünste. Die Devise lautet: „Aus alt mach neu!“ Fallschirmseide, Decken und Militäruniformen werden in zivile Kleidung verwandelt. Aus dem Garn von Fallschirmseilen werden Tischdecken gestrickt. Von Bauern kommt Löhnung in Form von Eiern, Speck oder Butter. Der Molkereibesitzer aus Lübzin, Proske, baut in Grevesmühlen mit unternehmerischem Elan eine Käsefabrik neu auf. Fortan gibt es als Nählohn für meine Mutter Harzerkäse in jeder Konsistenz von roh-weiß bis würzig-fließend mit und ohne Maden. Mit dem jüngsten, mit mir gleichaltrigen Proske-Sohn Rudi bin ich einige Zeit befreundet.
1947 wird langsam wieder ein eigenes Zuhause geschaffen, nachdem Proskes uns ihre Wohnung in der Bahnhofstraße 65 überlassen. Die ersten wieder eigenen Möbel kommen von Russen, für die meine Mutter näht.
An eine Rückkehr nach Hinterpommern ist nicht mehr zu denken. Grevesmühlen wird uns zur neuen Heimat und ich verbringe dort entscheidende Jahre meiner Jugend.
In den ersten Nachkriegsmonaten spiele ich viel mit gleichaltrigen Kindern in Gruppen und Horden aus der Nachbarschaft. Wenn wir durch Feld und Wald strolchen, wird im Herbst häufig eine Steckrübe vom Feld „geschlachtet“ und sofort verzehrt. Ich befreunde mich mit Hans Konang, *1.9.1934, einem etwa gleichaltrigen Flüchtlingsjungen und Gutbesitzerssohn aus Malwischken in Ostpreußen, der jetzt auch in der Wismarschen Straße wohnt.
In Grevesmühlen in Westmecklenburg wuchs ich zwischen meinem 10. und 18. Lebensjahr auf.
Bahnhofstraße in Grevesmühlen
Blick vom Kirchturm über die Stadt Grevesmühlen
Schulzeit in Grevesmühlen
1946 kommt das Schulwesen nach dem Krieg nach monatelanger Pause wieder zu neuem Leben. Ein Jahr habe ich verloren. Das 4. Schuljahr vollende ich in Grevesmühlen bei der Lehrerin Frau Daniels. Das 5. und 6. Schuljahr verbringe ich ebenfalls an der Fritz-Reuter-Schule in einer reinen Jungenklasse.
An einige Namen von Klassenkameraden kann ich mich noch erinnern: Günter Dankert, Eberhard Dettmann, später Tischler, Karl-Heinz Drews, *18.4.1935, später NVA-Offizier, Ingo Eggert, *3.8.1933 Lothar Gebühr, Später Arzt in Flensburg, Werner Gollub, *22.12.1934, Ulrich Hinkelmann, damals in den Leistungen recht durchschnittlich, später geistiger Senkrechtstarter und Physiker, Christian Martens, später Schmied, Kfz-Mechaniker und Maschinenbauingenieur, lebenslang in Grevesmühlen verblieben, Adolf Möller, Bauernsohn aus Grenzhausen, war mit mir im Jugendkreis und Posaunenchor, später Förster im Rheinland und 1960 bei Jörg-Michaels Taufe in Dortmund zu Gast, Heinz Moos, Erwin Nordengrün, Karl-Friedrich Nordengrün, später Maler in Delmenhorst, Rüdiger Proske aus Lübzin, Werner Roxin, Hans-Georg Schmeling, *1.11.1934, Manfred Schröbler, später Torwart bei Hansa-Rostock, Klaus Schüler, später überzeugter Marxist, Günter Stappenbeck, *2.5.1935, Kurt Weiß, später Bauingenieur, „Ganther“ Wulf.
Der über 70jährige reaktivierte Ostpreuße Eichert wird unser Klassenlehrer. Er ist streng, aber engagiert und vermittelt uns neben einem soliden Grundwissen auch sittliche Werte. Ich habe ihm viel zu verdanken. Deutsche Sprichwörter, Balladen und Gedichte zitiert er immer wieder neu und lässt sie uns auswendig lernen. Matthias Claudius’ Winterlied mochte er offenbar besonders gerne. In meiner Erinnerung assoziiere ich das „...der Winter ist ein harter Mann, kernfest und auf die Dauer. Sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an. Er scheut nicht süß noch sauer....“ mit Eicherts Bericht, er wasche sich jeden Morgen, auch im Winter, kalt und frottiere sich mit einem feuchten Handtuch den ganzen Körper. Auch das Kartoffellied von Matthias Claudius prägt er uns ein, dass ich es heute noch auf der Zunge habe:
„Pasteten hin, Pasteten her, was kümmern uns Pasteten, die Schüssel hier ist auch nicht leer und schmeckt so gut als aus dem Meer die Austern und Lampreten. Und viel Pastet und Leckerbrot verderben Blut und Magen. Die Köche kochen lauter Not. Ihr Herren, laßt’s euch sagen: Schön rötlich die Kartoffeln sind und weiß wie Alabaster, verdau’n sich lieblich und geschwind und sind für Mann und Weib und Kind ein rechtes Magenpflaster.“
Der über 70jährige reaktivierte Ostpreuße Eichert wird unser Klassenlehrer. Er ist streng, aber engagiert und vermittelt uns neben einem soliden Grundwissen auch sittliche Werte. Ich habe ihm viel zu verdanken. Deutsche Sprichwörter, Balladen und Gedichte zitiert er immer wieder neu und lässt sie uns auswendig lernen. Matthias Claudius’ Winterlied mochte er offenbar besonders gerne. In meiner Erinnerung assoziiere ich das „...der Winter ist ein harter Mann, kernfest und auf die Dauer. Sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an. Er scheut nicht süß noch sauer....“ mit Eicherts Bericht, er wasche sich jeden Morgen, auch im Winter, kalt und frottiere sich mit einem feuchten Handtuch den ganzen Körper. Auch das Kartoffellied von Matthias Claudius prägt er uns ein, dass ich es heute noch auf der Zunge habe:
„Pasteten hin, Pasteten her, was kümmern uns Pasteten, die Schüssel hier ist auch nicht leer und schmeckt so gut als aus dem Meer die Austern und Lampreten. Und viel Pastet und Leckerbrot verderben Blut und Magen. Die Köche kochen lauter Not. Ihr Herren, laßt’s euch sagen: Schön rötlich die Kartoffeln sind und weiß wie Alabaster, verdau’n sich lieblich und geschwind und sind für Mann und Weib und Kind ein rechtes Magenpflaster.“
Als wir das Lied von der Freiheit und dem Vaterland von Ernst Moritz Arndt bei ihm lernen, bedauert er, dass er uns nur die Verse zum Vaterland beibringen dürfe: „...o Mensch, du hast ein Vaterland, ein heiliges Land, ein geliebtes Land, eine Erde, wonach deine Sehnsucht ewig dichtet und trachtet..... Und wären es kahle Felsen und öde Inseln und wohnten Armut und Elend auf ihr, du sollst dieses Land ewig lieb haben....“, die zur Freiheit seien zu lehren verboten. Eines späteren Tages legt er mir nahe, nie Schulmeister zu werden. Da müsse ich mich zu sehr unter die jeweilige herrschende politische Meinung ducken. Am 30.7.1947, am Ende der 5. Klasse schreibt Eichert mir ins Zeugnis: „Bei stetem Fleiß und lebhafter Beteiligung am Unterricht waren die Leistungen immer gut.“ Bei 28 Schülern stand ich in der Klasse auf der Leistungsstufe an 7. Stelle. Neben Deutsch (Note 2) und Rechnen (2) wird auch Unterricht in Erdkunde (2), Biologie (2), Russisch (3), Zeichnen (2), Musik (2) und Körpererziehung (3), später auch Geschichte (2/3), Physik (2) und Chemie (3) erteilt. Im Fach Deutsch fühle ich mich immer einigermaßen sicher. Am 18.3.1948 erhalte ich im Kinosaal von Grevesmühlen vor der versammelten Schülerschaft nach einem Aufsatzwettbewerb unserer Schule aus Anlass der 100jährigen Wiederkehr der Revolution von 1848 für den besten Aufsatz zu diesem Thema eine Auszeichnung in Form einer Urkunde. In Ermangelung von Russischlehrern werden alle möglichen und unmöglichen Personen als Lehrer eingestellt, die über russische Sprachkenntnisse, aber nicht unbedingt über pädagogische Fähigkeiten verfügen. Von der Sorte ist auch mein erster Russischlehrer. Wir müssen einige russische Liedtexte und Sprichwörter lernen, um im Falle einer Unterrichtskontrolle unsere Künste unter Beweis stellen zu können. Nicht viel besser verhält es sich bei unserer nächsten Russischlehrerin, die wir „Babuschka“ nennen. Als ich auf Veranlassung Eicherts mit einigen Jungen meiner Klasse, später als andere Mitschüler, auf die Oberschule wechsele, fällt mir der Anschluß im Fach Russisch besonders schwer. Der Aufenthalt an der Oberschule dauert nur ein knappes Jahr. Dann werden alle unteren Klassen geschlossen an die „Deutsche Einheitsschule - Grundschule“ verlegt.
Wir kommen zur „Geschwister-Scholl-Schule“, wo wir die 7. und 8. Klasse zusammen mit unseren mitgewechselten Lehrern von der Oberschule, Frau Zellner (Russisch) und Fräulein Wiggers (Deutsch) durchlaufen.
Zu meiner Klasse gehören Anneliese Arendt, *10.1934, Ilse Au/Maaß, *12.1934, jetzt in Bad Bramstedt lebend, Walter Brüdigam (lebt nicht mehr), Hilke Carstensen, *14.10.1934, jetzt in Hamburg ?, Helga Deprie, *31.12.1934, Edith Ebell/Bindernagel, jetzt in Rostock-Lüttenklein lebend, Ingrid Freitag, später Lehrerin in Grevesmühlen, Marianne Grönecke, jetzt in Rostock lebend, Wolfgang Hartmann, jetzt als Chemiker in Chemnitzt lebend, Gerda Höckrich, *21.9.1934, verheiratete Rinnert, lebt in Grevesmühlen, Rotraud Hoffmeister, soll früh geheiratet haben und im Westen leben, Ilse Kelling, jetzt in Hamburg ?, Karin Knakowski, *1934, (lebt nicht mehr), Renate Krimlowski; *30.12.1934, Ulrich Liebsch, soll jetzt in der Nähe von Frankfurt/M. leben, Jochen Luckmann, lebte in Hamburg-Rissen, Christa Lüttjohann, mit Wolfgang Manja in Grevesmühlen verheiratet, Christian Martens, selbständiger Kfz-Mechanikermeister ind Ingenieur in Grevesmühlen, Horst Nagler, *7.8.1934, war Bilanzbuchhalter, jetzt Rentner in Stralsund, Inge Neumann, *23.8.1934, Marianne Pieplies, in Grevesmühlen verheiratet, Siegrid Raabe, Sabine Rabe/Schneider, Anke Reiher, in Schwerin mit einem Arzt verheiratet, Peter Reiher, *14.10.1933, später Zahnarzt in Gerolshofen, Werner Roxin, später Dachdecker (tödlich verunglückt), Dorothea Saborowski, Verkäuferin, Ivar Veit, aus dem Baltikum stammend und zeichnerisch besonders talentiert, später Professor für Akustik (wir haben hin und wieder eMail-Kontakt), Hans-Jürgen Wagenknecht, Lieselotte Wilms, *22.4.35, soll in München leben, Klaus Winter, späterer Kameramann beim DDR-Fernsehen.
Am 28. April 1949, meine Mutter ist 38, ich 14 Jahre alt, wird meine Schwester Karin als Ersatz für Inge-Lore in Grevesmühlen geboren.
Zu der Zeit verdiene ich mir ein kleines Taschengeld, indem ich zusammen mit meinem Freund Hans Gottschalk wöchentlich einmal abends bei einem Damenclub in Knochenarbeit Kegel aufstelle. Einen zweiten Job nehme ich für zweimal wöchentlich für je zwei Stunden am Nachmittag bei einem Seilermeister an, dem ich in seiner Reeperbahn helfe, Hanfseile in verschiedener Länge zu drehen.
Zum Abschluss der 8. Klasse haben wir eine Schulabschlussprüfung zu bestehen. Da mir Sprachen nicht liegen, die zu erlernen Voraussetzung für ein Theologiestudium wäre und ich deshalb Diakon werden will, dazu kein Abitur, wohl aber einen abgeschlossenen Beruf benötige, zum Besuch der Oberschule aber auch entsprechende „gesellschaftliche Voraussetzungen“ wie politische Anpassung verlangt werden, verlasse ich die Schule nach der 8. Klasse. Ich will zunächst Zahntechniker lernen und bekomme auch eine Lehrstelle bei einem kleinen Privatbetrieb. Dort habe ich den Eindruck, dass mein Lehrherr voll mit mir zufrieden ist. Nach vier Wochen, erklärt er mir plötzlich, ich eigne mich nicht für den Beruf und müsse innerhalb der Probezeit wieder gehen. Das trifft mich hart und wirft mich in starke Minderwertigkeitsgefühle. Kurz darauf wird mir berichtet, der Vater einer Klassenkameradin, die schulisch recht schwach war, habe auf Grund guter Beziehungen zu meinem Zahntechniker nachgeholfen, dass seine Tochter als Lehrling eingestellt wird. Einen Lehrling konnte der gute Mann aber nur gebrauchen, so dass ich im Wege war.
Fritz Reuter-Schule
Geschwister-Scholl-Schule
|
Nach der Flucht im März 1945 aus Hinterpommern lebte ich vom 10. bis 15. Lebensjahr in |
Bilder aus der Schulzeit
unten: 7 Klasse Geschwister-Scholl-Schule |
| Mein Weg zur Kirche
Posaunenchor Grevesmühlen
|
|
|
Posaunenchor in Grevesmühlen
|
weitere websites des Webmasters:
maritimbuch.hpage.com/
Diese Seite besteht seit dem 1.02.2020 - last update - Letzte Änderung: 11.09.2022
Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski